Synode: Österreich-Bericht priorisiert Frauen, Mission, Partizipation
Rückmeldungen aus Diözesen bringen klares Votum für Frauendiakonat und zahlreiche konkrete Vorschläge, um Mitwirken und Mitentscheiden von Laien und Klerus neu zu regeln
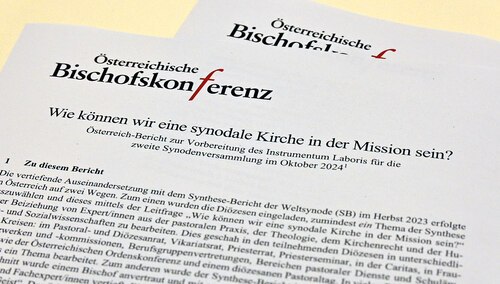
Wien, 15.05.2024 (KAP) Die Stellung der Frau in der Kirche, die missionarische Ausrichtung der Kirche und mehr innerkirchliche Partizipation - diese drei Themenbereiche sind für die Kirche in Österreich prioritär im Blick auf die nächste Welt-Synodenversammlung im Oktober in Rom. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Österreich-Bericht hervor, der am selben Tag an das vatikanische Synodensekretariat fristgerecht übermittelt wurde. Erstellt wurde der Bericht vom von der Bischofskonferenz eingesetzten nationalen Synodenteam unter dem Vorsitz von Erzbischof Franz Lackner, der als Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz auch an der Weltsynode teilnimmt.
Grundlage für den Österreich-Bericht sind die Rückmeldungen der Diözesen auf den Synthese-Bericht der Weltsynode (SB) im vergangenen Herbst. Weitere Rückmeldungen kamen von den fachlich zuständigen Bischöfen innerhalb der Bischofskonferenz, die gemeinsam mit den jeweiligen Fachleuten und kirchlichen Organisationen den Synthese-Bericht inhaltlich vertieften.
Das jetzt vorliegende Papier benennt auf acht Seiten insgesamt 14 Themenfelder. Die Reihung und Priorisierung ergibt sich aus der "Häufigkeit" der Rückmeldungen und der "Repräsentativität" der bearbeitenden Gruppe für die vertretenen Personengruppen, "wobei in der Gewichtung den diözesanen Beiträgen Vorrang gegeben wurde", wie es dazu einleitend heißt.
Starkes Votum für Frauendiakonat
Höchste Priorität hat im Österreich-Bericht der Themenbereich "Frauen im Leben und in der Sendung der Kirche", wo es heißt: "Herausragende Bedeutung für ein glaubwürdiges Kirche-Sein in der Mission kommt in den Rückmeldungen der 'Frauenfrage' zu." Zwar gebe es in der österreichischen Kirche gute Erfahrungen mit Frauen in kirchlichen Leitungspositionen, was aber nur als Teilantwort erscheine. Beklagt werde weiterhin ein "enormer Glaubwürdigkeitsverlust der Kirche und im Zusammenhang damit auch eine massive Gefährdung ihrer Sendung, solange diese Frage nicht (umfassend) zufriedenstellend gelöst ist".
Wie eine Lösung aussehen könnte, macht der Österreich-Bericht wie folgt deutlich: "Während das Frauenpriestertum vereinzelt angesprochen wird, gibt es ein starkes Votum, getragen von Mehrheiten in den Diözesen (inklusive Diözesanleitungen, Linzer Diakone), für die Zulassung von Frauen zum Diakonat." Die dafür angeführten Argumente beziehen sich sowohl auf die Bibel als auch auf Lehraussagen beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Resümierend heißt es: "Auf der Basis einer theologisch fundierten Grundsatzentscheidung könnte es eine entsprechende Anpassung des Kirchenrechts geben. In der Folge könnten die von Frauen erfahrenen Berufungen gesehen und geprüft, Ausbildungen angeboten und Frauen in den Ortskirchen zum sakramentalen Diakonat geweiht werden."
Mission und Partizipation
Die zweithöchste Wichtigkeit wird im Österreich-Bericht dem Thema "Kirche ist Mission" beigemessen. Grund dafür dürfte nicht zuletzt folgende lapidare Feststellung sein: "Generell zeigt sich, dass die Kirche in Österreich Mission neu lernt und lernen muss." Schlüsselbegriffe für eine missionarische Haltung seien Dialog, Praxis und Inkulturation. Gefordert seien missionarische "Qualitäten", wie "der Mut zum Zeugnis, die persönliche Glaubwürdigkeit wie auch die Fähigkeit, Menschen wertschätzend zuzuhören und auf ihre Bedürfnisse einzugehen - insbesondere in Bezug auf kritische Menschen oder in Konflikten".
Der vatikanische Synthese-Bericht wird aber auch hinterfragt, wenn es heißt: "Die Fokussierung auf die Familie als zentrales Subjekt der Sendung als 'Rückgrat der Kirche' wird kritisch gesehen, weil im deutschsprachigen Raum nicht mehr ausschließlich Familien ('Hauskirche') die Kirche tragen, sondern transfamiliale Gemeinschaften und Gemeinden zunehmend stärker die Sendung der Kirche verwirklichen."
Als vordringlich für die Glaubwürdigkeit einer synodalen Kirche wird "das Miteinander von Priestern und Laien und die gleichwertige Mitgestaltung des kirchlichen Lebens" gesehen. Diese Thematik steht an dritter Stelle der Prioritätenliste und betrifft die kirchlichen Strukturen. "Geweihte und Nichtgeweihte [sollen] in die Entscheidungen auf allen Ebenen der Kirche eingebunden werden", ist zu lesen. Entwickelt werden müsse "eine Kultur der echten Mitentscheidung, nicht nur der Beratung oder Beteiligung an der Entscheidungsfindung". Es brauche u.a. transparente Entscheidungsvorgänge und die Rechenschaftspflicht funktionierender Gremien nach innen und nach außen.
Priester, Zölibat, Krankensalbung
"Die Anforderungen an Priester heute verlangen nach neuen Formen der Ausübung des priesterlichen Dienstes. Empfohlen wird, die Weihezulassungen zu weiten sowie regionale Lösungen mit Probephasen anzudenken", ist im Österreich-Bericht als Generalperspektive zu lesen. Ob das auch eine Freistellung von der Zölibatsverpflichtung für Weltpriester beinhaltet, wird nicht gesagt.
Dafür heißt es an anderer Stelle dazu: "Es wäre notwendig, den Zölibat als einen 'letzten Rest christlicher Radikalität' besser vorzubereiten, zu begleiten und in verschiedene Formen des Gemeinschaftslebens einzubetten." Angedacht werde auch ein Zölibat "auf Zeit'". Denn ein nicht geglücktes zölibatäres Leben könne auch Krankheiten zur Folge haben. Auch gehöre der Umgang mit "Priestern ohne Amt" bezüglich der Versorgungspflicht oder eines erneuten Einsatzes von laisierten Priestern nach dem Tod der Gattin oder einer Scheidung überdacht.
Deutlich wird der Österreich-Bericht bei der Krankensalbung, die bisher nur Priester spenden können, wo es wörtlich heißt: "Das Sakrament der Krankensalbung sollte allen Krankenseelsorger/innen für Kranke offenstehen", wird festgehalten.
In den Stellungnahmen der beteiligten Kleriker zeige sich der Wunsch zur "Teamarbeit" mit den Laien, ist zu lesen. Auch brauche es eine Präzisierung des Begriffs "Klerikalismus" im Sinne einer Unterscheidung zwischen einer legitimen und einer klerikalistischen Machtausübung. Ein besonderes Augenmerk soll demnach auch auf die Aus- und ständige Fortbildung für Priester und andere pastorale Berufsgruppen gelegt werden.
Bischof und Bischofskonferenz
Der Bischof solle "als sichtbares Zeichen der Einheit" die Einheit der kirchlichen Weggemeinschaft fördern, diese begleiten und "ihr Orientierung gebend vorangehen, damit das Ziel im Blick bleibt", ist im Bericht zu lesen. "Er wahrt die Tradition und fördert zugleich Innovation." Zur Erfüllung dieser Aufgabe brauche es "Leadership", aber auch die "kirchenrechtliche Stärkung der Partizipation (insbesondere der Laien)". Vorgeschlagen wird in diesem Zusammenhang, dass die "Beispruchsrechte" - also verpflichtende Beratungs- oder Zustimmungsrechte Dritter - gesamtkirchlich ausgebaut werden. Auch brauche es "eine Verpflichtung zu synodalen Gremien".
Zudem werde es als wichtig erachtet, die Rolle der Bischofskonferenzen sowie die Kollegialität national und weltkirchlich aufzuwerten und zu stärken: "Bischofskonferenzen könnten z.B. bei der Suche nach Kandidaten für das Bischofsamt, bei der Bischofsernennung oder der Überprüfung bischöflichen Handelns mitwirken."
Ökumene, Caritas, digitale Welt, Theologie
Konkrete Anregungen aus Österreich kommen zur Ökumene, wo hierzulande die vielfältige Zusammenarbeit und herzliche Verbundenheit zwischen den christlichen Konfessionen hervorgehoben wird. So wünsche man sich von der Synode ein gemeinsames Osterdatum orientiert am Julianischen Kalender sowie die Anerkennung und allgemeine liturgische Verwendung des Großen Glaubensbekenntnisses, jedoch ohne "filioque". Weiters wird vorgeschlagen, für konfessionsverbindende Ehepaare eucharistische Gastfreundschaft zu ermöglichen. Auch der interreligiöse Dialog könnte in ökumenischer Kooperation erfolgen: "Gemeinsam könnten sich die Religionsgemeinschaften für den Frieden einsetzen und wach und aktiv der politischen Vereinnahmung von Religion widerstehen."
Eigens thematisiert werden vielfältigen Formen materieller, aber auch geistiger und spiritueller Armut nicht zuletzt in Österreich. Das Wirken der Caritas und der Kampf gegen Armut gehe aber über das karitative Handeln hinaus "und umfasst auch den Einsatz für (internationale) soziale und ökologische Gerechtigkeit". Die Verantwortung für Armutsbekämpfung dürfe nicht bloß an die Caritas delegiert werden, denn: "Das Bewusstsein für die Mitverantwortung für eine globale sozio-ökologische Transformation wie auch eine Sicht auf Arme als Protagonisten auf dem Weg der Kirche muss bei vielen Gläubigen erst noch geweckt werden."
Der Österreich-Bericht merkt an, dass ein eigenes Kapitel über junge Menschen im Synoden-Bericht fehlt. Positiv sei aber die Thematisierung der Digitalisierung im Zusammenhang mit jungen Menschen, die sich wesentlich im digitalen Raum aufhalten. Kirche benötige daher in der digitalen Welt mehr Präsenz. So werde beispielsweise vorgeschlagen, ein Dach "Digitale Kirche Österreich" zu schaffen, "das unterstützt, vernetzt, professionalisiert, fördert". Auch solle die Kirche "qualitativ hochwertige Informationen" im Netz zur Verfügung stellen - nicht zuletzt im Blick auf KI-Systeme, die immer mehr die Deutung übernehmen und darauf zugreifen könnten.
Der letzte Themenbereich im Österreich-Bericht ist der Theologie und ihrem Dienstcharakter gewidmet. Kritisch wird angemerkt, dass die Theologie im bisherigen Synodalen Prozess eine zu geringe Rolle gespielt hätte. Dabei bräuchte es eine vertiefte theologische Reflexion über die "Spannung zwischen Hierarchie und Synodalität". Offen sei auch die Frage, "wie man vom Hören zum synodalen Unter- und Entscheiden kommt".
Synodaler Prozess impliziert Kulturwandel
Der Österreich-Bericht resümiert: "Insgesamt zeigt die vertiefende Auseinandersetzung verschiedener Teile der österreichischen Kirche, dass der Synodale Prozess in Österreich angekommen ist und von vielen mit Dankbarkeit und Engagement aufgegriffen wird. Die Kirche in Österreich steht hier freilich am Beginn eines Weges: in den nächsten Jahren wird in verschiedensten Bereichen und auf allen Ebenen zu lernen sein, dass Synodalität kein Sonderthema ist, das mit der zweiten Synodenversammlung im Oktober 2024 wieder ad acta gelegt werden kann, sondern einen tatsächlichen Kulturwandel impliziert."
Der Synoden-Bericht von der ersten Vollversammlung der Bischofssynode im Oktober des Vorjahres bildet gemeinsam mit den jetzt abgegebenen Länder-Berichten aus der ganzen Welt u.a. die Basis für das noch im Vatikan zu erarbeitende Arbeitsdokument ("Instrumentum Laboris"). Es wird in den nächsten Monaten erwartet und ist der inhaltliche Ausgangspunkt für die zweite und abschließende Vollversammlung der Bischofssynode im Oktober im Vatikan.
Neben dem Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Lackner, gehören dem nationalen Synodenteam Pastoral-Bischof Josef Marketz, Bischofskonferenz-Generalsekretär Peter Schipka, die Innsbrucker Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb sowie die Theologinnen Petra Steinmair-Pösel, Regina Polak und Klara-Antonia Csiszar. Letztere hat als Expertin (ohne Stimmrecht) an der Synode im Oktober teilgenommen. Stimmberechtigte Mitglieder aus Österreich an der Synodenversammlung sind Erzbischof Lackner und Kardinal Christoph Schönborn.
(Bericht: kathpress.at)
