Suizid – zwischen Tabu und Geheimnis
Herwig Oberlerchner und Johannes Staudacher im Gespräch mit Georg Haab
Der Suizidgedanke ist nicht Ausdruck einer Todessehnsucht, sondern einer Sehnsucht nach Veränderung: Psychologie und Theologie im Gespräch dazu.
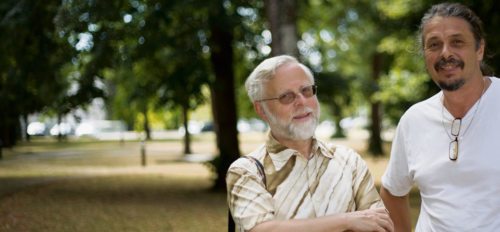

Seelsorge und Psychiatrie – zwei sich ergänzende Ansätze, sich mit Suizid und Betroffenen auseinanderzusetzen?
Oberlerchner: Die Psychiatrie ist auch dafür zuständig, suizidale (suizidgefährdete, Anm. d. Red.) Menschen zu behandeln. Suizidalität wird als Symptom einer psychischen Erkrankung erachtet. Es ist unser großes Anliegen, Menschen in suizidalen Krisen beizustehen. Mich interessiert daher auch, wie die Kirche mit diesem Thema umgeht. Früher wurden Suizidenten außerhalb der Friedhofsmauer begraben. Heute habe ich Seminare mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern, es hat sich vieles entwickelt.
Staudacher: Diese Haltung war oft nicht nur kirchlich, sondern auch gesellschaftlich bestimmt. Man hatte große Angst vor dem Thema. In vielen Kulturen wurden Suizidenten nicht im normalen Bereich bestattet. Man hatte Angst, dass sie wiederkommen und uns anstecken. Menschen kommen ja zum Friedhof, z. B. an Allerheiligen, um positiven Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen. Von diesen Toten aber wollte man nichts, man fürchtete sie. Die Kirche hat aber im letzten Jahrhundert auch durch das Gespräch mit der Psychologie einen Lernprozess mitgemacht. Suizid ist nicht Bosheit, sondern Not. Den letzten Schritt hat das neue Kirchenrecht von 1974 gesetzt. Gott sei Dank: Jetzt können wir den Hinterbliebenen als Seelsorger beistehen.
Suizid – auch heute noch ein Tabu-Thema?
Staudacher: Heute wissen wir, dass es nicht in diesem Sinne ansteckend ist, sondern umgekehrt: Das Thema anzusprechen, bringt mehr. Wie manchmal Angehörige sagen: Das Schlimmste war, kein Mensch hat mit mir geredet. Wenn es ehrliche, teilnahmsbereite Gespräche gibt, ist für die Betroffenen viel getan.
Oberlerchner: Ich erinnere mich an einige berührende Gespräche nach einem Suizid. Angehörige wollen viel Information, geben ihrer Trauer, ihrem Unverständnis, oft auch ihrer Wut und ihren
Schuldgefühlen Ausdruck. Dahin zu kommen, ist Sinn des Gesprächs. Erst wenn dieses Sprachlose zu sprechen beginnt, können die Emotionen herauskommen. Das ist dann fast wie gemeinsames Gebet. Oft wird diskutiert, warum es zu einer Häufung von psychischen Erkrankungen oder Suiziden in Familien kommt. Ich glaube, dass der tabuisierte, der nicht besprochene, nicht betrauerte Suizid eventuell den Suizid in der nächsten Generation vorbereitet. Deshalb ist es so wichtig, Trauerprozesse in Gang zu halten oder überhaupt erst zu initiieren, selbst wenn es Jahre später ist.
Was steht dem entgegen?
Oberlerchner: Es gibt vier verbreitete Fehlmeinungen. Die erste: „Suizid ist selten“. Stimmt nicht, 2012 hatten wir z. B. in Kärnten 97 Suizide, mehr als doppelt so viele wie Verkehrstote. Dann: „Es ist besser, sie nicht anzusprechen.“ Im Gegenteil, aktives Ansprechen ist hilfreich. „Suizid wird nicht angekündigt.“ Falsch, Menschen sind sehr rege in ihrem Mitteilen und oft sehr konkret, setzen Abschiedsgesten, deuten Abschiedsrituale an. Und: „Man kann eh nichts dagegen tun.“ Das ist eine resignative Fehlmeinung, Suizide können sehr wohl verhindert werden, wenn jemand verantwortungsvoll mit einem Suizidverdacht umgeht, mit dem Betroffenen redet und fachliche Hilfe holt, notfalls auch gegen dessen Willen.
Suizid – ein Appell?
Oberlerchner: Wenn man davon ausgeht, dass der Suizidgedanke nicht Ausdruck von Todessehnsucht ist, sondern einer Sehnsucht nach Veränderung, dann fragen wir: Was könnte sich jetzt ändern? Im Allgemeinen hat es etwas mit dem subjektiven Gefühl mangelnder Anerkennung, sozialer Isolation und Einsamkeit zu tun oder schlicht mit Dingen wie Schmerz. Beim alten Menschen im letzten Lebensabschnitt oft auch mit dem Reifungsauftrag, eine Aussöhnung mit der Biografie zu erreichen. Keine im Sinn von etwas wegwerfen oder nicht wertschätzen, sondern im Sinn von „mir die Kostbarkeiten meiner Biografie nochmals vor Augen zu führen, das Geglückte anzunehmen“. Auf diese Weise gelingt es, eine Lebensbilanz zu ziehen, die mit einem guten Gefühl, mit einem Ausklang zu tun hat.
Staudacher: Reif werden heißt auch: Die Realität mit einem gewissen Frieden als Gegebenheit nehmen können. Warum konnte die Kirche die Annahme der Realität, gerade auch des Begrenzten, so wenig vermitteln? Ich denke, sie hat es versucht über den Gedanken der Erbsündigkeit des Menschen, aber diese Sprache ist nicht angekommen. Aus seelsorglicher Sicht ist mein Lieblingssatz aus dem Johannesbrief im Blick auf alles Zerbrochene: „Gott ist größer als unser Herz, und Gott weiß alles.“ Dieses grundpositive Gottesbild ist ein Schlüssel.
Suizid als letzter Ausweg trifft auf immer mehr gesellschaftliches Verständnis.
Oberlerchner: Natürlich gibt es die Wahrnehmung: Wenn so viel zusammenkommt, ist es dann nicht legitim zu sagen, ich will nicht mehr? Aber tatsächlich ist Suizidalität fast immer Ausdruck gut behandelbarer psychischer Erkrankungen und Krisen. Wir finden immer wieder Alternativen, also statt Suizid ein Aussöhnen mit dem Schicksal, gute Schmerztherapie, sorgfältige Medikation und Psychotherapie, konkrete Gespräche mit Angehörigen.
Staudacher: Ja, das sehe auch ich als Schlüssel zur Suizidprävention. Als Seelsorger setze ich auf Ressourcen, dass jemand entdeckt: Was hilft mir, dass ich weiterleben möchte? Damit lässt sich auch seelsorglich etwas stärken. Ich habe noch nie mit dem Satz gearbeitet, dass das von Gott verboten ist – es wäre zumeist nicht hilfreich.
Ist der Glaube Hilfe zum Leben?
Oberlerchner: Dazu gibt es sehr umfangreiche Veröffentlichungen, zweifelsohne hat der Glaube eine suizidpräventive Potenz. Es ist auch ein Auftrag an die Ärzte und Psychologen, vor dem individuellen Glauben, welche Form er auch immer hat, großen Respekt zu haben. Er ist eine Ressource, die man jemandem auf keinen Fall nehmen darf.
Staudacher: Der Glaube stärkt die Hoffnung, hier hat die Kirche einen großen Auftrag. In der Begegnung mit Angehörigen ist mir eine weitere seelsorgliche Aufgabe bewusst geworden: Nämlich vom Geheimnis des Menschen überhaupt auszugehen. Wie wichtig ist der Respekt vor dem Schritt eines Menschen! Dieser Respekt ermöglicht, die Entscheidung eines Anderen als Teil dessen Lebens zu sehen. Mir ist wichtig, dass Suizid ein Geheimnis ist. Ein Geheimnis dieses Menschen, seiner Geschichte, seines Schrittes.
Ein Anliegen, das Ihnen noch am Herzen liegt?
Oberlerchner: Die Schuldfrage der Hinterbliebenen. Hier gilt es, Angehörige in Gesprächen zu entlasten. Die Idee gefällt mir gut: Das ist ein Geheimnis, das dieser Mensch mit in den Tod nimmt. Wir können nur mutmaßen, herumrätseln, aber letztendlich bleibt seine Entscheidung etwas uns Verborgenes, was wir zuletzt akzeptieren müssen. Bei diesem Trauer- und Erkenntnisprozess gilt es, die Hinterbliebenen zu begleiten.
Staudacher: Das grundpositive Gottesbild und einfach auch das Sich-Schicken ins „Ich kann es nicht und muss es nicht verstehen“. Im Jakobusbrief steht, dass die Zunge in dieser Welt die schlimmste Waffe ist, und gerade Christen sollten sich sehr genau fragen: Wie reden sie über Menschen und Umstände bei Suizid? Der Schritt in die Verleumdung ist ein sehr kleiner. Und vor allem hilft das ganz sicher niemandem. Ich wünsche mir, dass wir in solcher Not einfach liebevoller und respektvoller miteinander umgehen.
Zur Person
Dr. Herwig Oberlerchner ist Primar der Landespsychiatrie Klagenfurt, Pädagoge und Psychotherapeut.
Mag. Johannes Staudacher, Pfarrer in Klein St. Veit, ist seit 2004 Seelsorger für Hospiz- und Trauerbegleitung sowie Leiter von Seminaren für Suizid-Betroffene.
Anlaufstellen
Psychiatrischer Not- und Krisendienst: 0664/30 07 007 (Kärnten Ost) bzw. 0664/30 09 003 (Kärnten West)
Abteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Klagenfurt (0463/538-22970) und am LKH Villach (04242/208-3729)
Telefonseelsorge: 142 (ohne Vorwahl)
Lebensberatung der Caritas: 0463/50 06 67
Haus- und Fachärzte
Psychotherapeuten
Im Internet:
Suizidprävention Österreich (Bundesministerium für Gesundheit)
www.kriseninterventionszentrum.at

__large.png)