40 Jahre Caritas - ein Rückblick
Im "Sonntag" spricht Viktor Omelko über die Idee der Caritas, Hilfe und seine Anfänge bei der Caritas
Viktor Omelko prägte 40 Jahre lang die Caritas Kärnten. Er gilt als unermüdlicher sozialer Innovator. Ein Gespräch über den Caritas-Gedanken, Hilfe zur Selbsthilfe, die großen Herausforderungen der Zukunft und das Erfolgsrezept eines Caritas-Direktors.
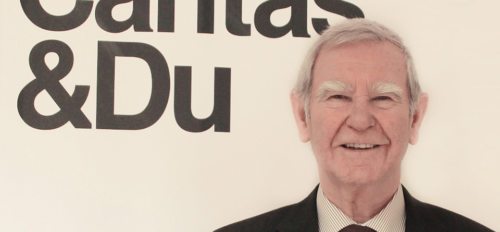

Am 1. September beenden Sie Ihre Tätigkeit als Caritasdirektor. Dann waren Sie mehr als 40 Jahre in diesem Amt. Was macht „Caritas“ aus?
Omelko: Wer bei der Caritas arbeitet, muss die Menschen lieben. Er braucht die Fähigkeit, mit Menschen wertschätzend umzugehen und nüchtern gemeinsam mit ihnen zu überlegen, wie man ihre Situation verändern kann.
Biblisch gesprochen: Den Menschen zur Umkehr helfen?
Omelko: Wenn wir über Bekehrung predigen, dann ist das Helfen immer eine kleine Bekehrung. Nur dann ändert sich etwas zum Besseren. Die Menschen müssen ihre Situation reflektieren und dann etwas ändern. Darum geht es, damit die Menschen ohne weitere Hilfe ihren Weg machen können. Die Hilfe zur Selbsthilfe wurde zwar zum Schlagwort, sagt aber präzise aus, was unsere Arbeit ausmacht.
Der Helfer muss sich zurücknehmen?
Omelko: Es wäre gefährlich, wenn Leute bei uns sind, die Wohltäter sein wollen. Es geht nicht darum, der Gute zu sein. Man muss immer schauen, wie gut ist der, der Hilfe braucht. Wie kann ich das Gute, das jeder Mensch hat, so entwickeln, dass es mehr wird und eine Hilfestellung von außen nicht mehr notwendig wird. Das ist das ganze Geheimnis der Caritas.
Manchmal hat man das Gefühl, Armut „bricht aus“. Das heißt, immer mehr Menschen, die in einem intakten Umfeld leben, benötigen plötzlich Hilfe, Stimmt dieser Eindruck?
Omelko: Man lebt in einem gewissen Netzwerk. Wenn dieses hält, funktioniert vieles ohne Hilfe von außen. Wenn dieses zugrunde geht – durch Scheidung oder Arbeitsplatzverlust – dann ist ein Grundknoten kaputt und es gibt Schwierigkeiten.
Man könnte Sie als sozialen Erfinder bezeichnen. Kärnten war für viele Projekte österreichweit Vorbild. War das alles geplant?
Omelko: Vieles kommt einfach auf dich zu. Wenn ein Erdbeben in Friaul ausbricht, dann muss man etwas tun. Insofern helfen alle Planungen und Visionen nichts. Wenn etwas passiert, ist unsere Hilfe gefragt. Das ist im Großen so aber auch im Kleinen. Die Situation ist klar, und gemeinsam muss man überlegen, was man macht.
Sie haben in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle eingenommen. Was sind Ihre wichtigsten Wegmarkierungen?
Omelko: Nach 40 Jahren ist das gar nicht so einfach. Etwa bei den Kindergärten gab es gleich im ersten Jahr massive Finanzierungsprobleme. Die wurden dann in Kooperation mit den Gemeinden und dem Land gelöst. Nicht ohne dass ich hier politisch gleich einmal zu Beginn meiner Tätigkeit ordentlich dreinfahren musste. Dann kam das Erdbeben in Friaul. Das ist eine Situation, die man ja nirgends lernt. Gerade in der Katastrophenhilfe muss man ziemlich querdenken. Das läuft nicht nach Plan ab. Wir hatten damals eine Handvoll ehrenamtlicher Mitarbeiter, mit denen wir ein Konzept entwickelt haben, das österreichweit Vorbild wurde. Dann kam das Erdbeben in Süditalien, dann die Auslandshilfe in Afrika und schließlich der Jugoslawien-Krieg mit „Nachbar in Not“.
In Kärnten war ja auch viel zu tun ...
Omelko: Natürlich haben wir parallel dazu in Kärnten einige Projekte umgesetzt. Wir haben als eine der ersten Caritasorganisationen mit der Suchtberatung begonnen. Die Lebensberatung ist in Kärnten bei der Caritas und auch die Telefonseelsorge haben wir 1977 gegründet. So können wir den Menschen in all ihren Nöten beistehen. Die Beratungsstellen sind so gelegt, dass man nicht von vornherein weiß, wo die Leute hingehen. So bleibt eine anonyme Beratung garantiert.
Manche Ihrer Projekte haben von Kärnten aus Österreich „erobert“. Die Kärntner Caritas war in vielem ein Vorbild. Haben Sie konkrete Beispiele?
Omelko: Wir haben österreichweit mit den Kleiderläden begonnen, aber auch mit der Obdachlosenarbeit. Die berühmte Wiener „Gruft“ kam erst später. Die Auslandshilfe war auch für ganz Österreich gut geregelt. Es gibt immer noch Felder, wo man noch etwas tun könnte. Denken Sie an „Talitha“ für Opfer des Menschenhandels, ebenfalls ein österreichweit beachtetes Angebot. Glücklicherweise haben wir mit Sr. Silke die richtige Person dafür. Und wir stellen ihr den notwendigen Rahmen zur Verfügung. Ähnlich war es mit Peter Quendler. Er hat diese Dinge gut und gerne gemacht und war weltweit unterwegs. Anfangs ehrenamtlich.
Apropos Ehrenamt: Die Caritas lebt in vielen Bereichen vom Engagement Ehrenamtlicher. Ist es schwerer geworden, Ehrenamtliche zu finden?
Omelko: Ehrenamtliche findet man immer dann, wenn man vernünftige Tätigkeiten anbieten kann. Wir haben vor zwei Jahren bemerkt, dass es für Asylwerber zu wenig Sprachkurse gibt. Wir haben gesucht und jetzt laufen die Kurse mit Ehrenamtlichen perfekt. Die Auslandshilfe läuft bei uns vorrangig durch Ehrenamtliche, aber auch die Telefonseelsorge, wo wir gezielt Leute gesucht und ausgebildet haben. Dann gibt es den Shop, den ausschließliche Ehrenamtliche leiten. In den Pfarren sind ohnehin hauptsächlich Ehrenamtliche aktiv. Auch in der Alten- und in der Hospizarbeit hat sich vieles ehrenamtlich entwickelt. So gibt es bei uns Möglichkeiten von der Wiege bis zur Bahre. Das Wertvolle an Ehrenamtlichen ist ja auch, dass sie neue Ideen bringen. Daher sind für mich Ehrenamtliche ein wesentliches Salz in der Suppe, weil sie zusätzliche Bewegung in eine Organisation bringen. Das ist für jede Organisation, die in Gefahr ist, in bestimmten Kreisen zu rennen, lebenswichtig.
Was würden Sie als Kernbereich der Caritas bezeichnen?
Omelko: Eigentlich sind die Sozialberatung und Lebenshilfe unser erstes Aufgabengebiet. Da entwickeln wir mit Leuten gemeinsam die weitere Hilfe. Daher ist sie in der Caritas auch zentral angesiedelt. Drumherum entwickeln sich dann die anderen Einrichtungen. Anfang der 80er Jahre hatten wir einen massiven Wirtschaftseinbruch. Da war die Nachfrage so groß, dass wir eine andere Anlaufstelle brauchten. So hat sich die Obdachlosenhilfe entwickelt. Dort werden Probleme gelöst, die sonst schwer in den Griff zu bekommen wären. Ein anderes Beispiel: Als die Jugendarbeitslosigkeit in Kärnten enorm anstieg, musste etwas getan werden. Das beste ist meiner Meinung nach eine solide Ausbildung. So haben wir die dreijährige Fachschule gegründet. Wir hatten zu dieser Zeit auch einen Mangel an Fachkräften für die Altersheime – so gründeten wir die fünfjährige Fachschule mit Matura. Die Dinge sind also nicht entstanden, weil es mir Spaß gemacht hätte, sondern weil eine konkrete Not dahinter stand. Deswegen haben sich alle diese Projekte bis heute bewährt.
Wo sehen Sie große Herausforderungen heute?
Omelko: Wie es um die Wirtschaft steht, sehen wir an der Nachfrage nach der Sozialausbildung. Derzeit haben wir eine enorme Nachfrage. Das freut uns, weil alle, die diese Schule machen, einen Job bekommen. Das wird so noch lange bleiben. Ein aktuelles Problem ist der Pflegebereich durch die massive Zunahme der 24-Stunden-Pflege. Dieses Gesetz wurde damals im Ho-Ruck eingeführt. Wir haben schon etwa 3000 Personen, die zumeist aus dem Osten kommen und bei uns als freiberuflich Pflegende arbeiten. Die machen den Pflegeheimen aber auch den mobilen Diensten Konkurrenz.
Die Caritas ist in Kärnten einer der größten Pflegeheim-Betreiber. Jetzt gibt es ja Diskussionen um die Pflegeplätze. Wie sehen Sie die Situation?
Omelko: Wie gesagt: Wenn man die 3000 Pflegerinnen aus dem Osten nicht hätte, gäbe es einen eklatanten Mangel an Pflegebetten. Damals, als wir mit den Pflegeheimen begannen, gab einen riesigen Bedarf, den niemand gedeckt hat. Die Privaten sind erst auf den Plan gekommen, als das Pflegegeld eingeführt wurde. Bis dahin war es sehr mühsam. Vor zehn Jahren haben wir die letzten Häuser gebaut. Seither wird nur noch in die Qualität und Modernisierung investiert.
Federführend ist die Caritas ja auch in der Behindertenbetreuung ...
Omelko: Die haben wir in den vergangenen Jahren ausgebaut. Noch vor zehn Jahren gab es kaum Betreuungseinrichtungen. In Globasnitz entstand etwa ein ganz wunderbares Projekt von Kärnten und Slowenien gemeinsam. Es ist ein wunderschönes Modell, das auch politisch sehr unterstützt wird, aber es funktioniert im Moment aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation hüben wie drüben nicht so gut.
Mit der Politik war es sowieso nie ganz einfach. Wie sehen Sie die Lage rückblickend?
Omelko: Schon wie ich gekommen bin, herrschte eine Partei, die nicht unbedingt Caritas-freundlich war. Die sozialen Belange waren ideologisch Sache der Partei. Vor allem die Erdbebenhilfe in Friaul hat da zu einem besseren Gesprächsklima geführt. Aber auch bei Fragen wie der Suchtberatung gab es nach anfänglichen Widerständen eine gute Kooperation. So sind kleine Schritte gelungen, die schlussendlich zu gemeinsamen Zielen geführt haben.
Aber es konnte doch einiges politisch umgesetzt werden. Was waren die größten politischen Erfolge?
Omelko: Eine wichtige Errungenschaft war der Mütterfond, der ja aus der Synode her entstanden ist. Damals erhielten Frauen mit wenigen oder keinen Versicherungszeiten kein Karenzgeld. So haben wir begonnen, schwangere Frauen anzustellen, damit sie diese Anwartschaft erwerben konnten. Eines Tages wurden wir deswegen von der Gebietskrankenkasse zur Rede gestellt. Aber wir konnten immer nachweisen, dass die Leute auch wirklich gearbeitet haben. So wurde aber die Diskussion in Schwung gebracht, und man erkannte, dass hier eine soziale Lücke besteht. Ich habe auch immer betont, dass die Voraussetzung für das Karenzgeld nicht die Arbeitszeiten sein können, sondern immer das Kind sein muss. Also ist der Ansatzpunkt falsch gewählt. Dann wurde das geändert und heute bekommen die Leute Karenzgeld für das Kind.
Der Kärntner Beharrlichkeit ist ja auch die Änderung des Sozialhilfegesetzes österreichweit zu verdanken. Wie kam es dazu?
Omelko: Mit dem Sozialhilfegesetz war es ähnlich. Wir haben in der Arbeit gemerkt, dass die Leute keine Sozialhilfe wollten, weil sie alles zurückzahlen mussten. Das war für uns der Ansatzpunkt zu sagen: So kann es nicht sein. Die Leute, die Hilfe brauchen, haben nichts und werden so schnell auch nichts haben. Also hat es keinen Sinn, auf Rückzahlung zu drängen. Also braucht es eine andere Lösung für jene, die nichts haben. So ist die Regresspflicht auf jede Sozialleistung gefallen und das Mindestsicherungsgesetz ist entstanden. Da haben wir in der Caritas Österreich einen wichtigen Beitrag geleistet. In der konkreten Arbeit mit den Menschen sieht man, wo die wirklichen Probleme liegen und wie man sie ändern kann. Langfristig geht das nur mit strukturellen Änderungen. Da ist viel gelungen, aber noch immer manches offen.
Offen ist etwa das Bettlerquartier in Klagenfurt. Waren Sie vom massiven Widerstand überrascht?
Omelko: Ja, der Widerstand hat mich überrascht. Vor allem auch, dass der Bürgermeister gesagt hat, er hätte davon nichts gewusst. Wir haben immerhin zwei Jahre lang darüber diskutiert. Bürgermeister Scheider hat ein Gremium zusammengerufen, wo er klar gesagt hat, man müsste etwas tun. Dann gab es noch eine Diskussionsrunde der KTZ mit dem Ergebnis, dass etwas geschehen soll. Aber offenbar hat es jetzt in die politische Stimmung gepasst, dagegen zu sein.
Wie soll es mit dem Bettlerquartier in Klagenfurt weitergehen?
Omelko: Wir sind noch immer im Diskussionsprozess. Es heißt ja oft, die Fremden sind da, tun nichts und lassen es sich gut gehen. Dass sie nichts tun ist leider richtig, weil sie nichts tun dürfen. Dass sie es sich gut gehen lassen, ist aber ein Unsinn. Es geht ihnen nicht gut. Diese Debatte macht die Situation aber schwieriger. Nichts desto trotz bin ich sehr froh, dass so viel diskutiert wurde. Es wurde in ganz Kärnten zur Kenntnis genommen. Ich sehe es auch als wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag, dass sich möglichst viele Menschen mit dieser Situation beschäftigen. Daher ist diese Diskussion wichtig. Ich bin überzeugt, dass auch diese Art der Hilfe, wie ich sie geplant habe, umgesetzt wird.
Wie beurteilen Sie generell den Umgang mit Randgruppen? Hat sich die Stimmung geändert?
Omelko: Es war nie leicht. Als wir die Obdachlosenstelle eröffnet haben, gab es heftige Stimmen dagegen. Durch unsere Arbeit wurde aber die Situation etwa in den Klagenfurter Pfarren wesentlich entspannter. Man konnte die Leute rund um die Uhr und jeden Tag zu uns schicken. Ein weiterer Erfolg: Seit wir die Stelle haben, ist in Klagenfurt niemand mehr erfroren. Das sind positive Auswirkungen, die wir präsentieren konnten. Man sieht in Klagenfurt auch keine abgerissenen „Sandler“ mehr. Aufgrund der positiven Erfolge haben wir schon gemerkt, dass die Bevölkerung diese Tätigkeit akzeptiert.
Immer wieder müssen heute Sparzwang und Geldnot als Argumente in der sozialen Debatte herhalten. Spüren Sie das?
Omelko: Es braucht ja gar nicht viel Geld, damit den Menschen das Leben erleichtert wird. Das braucht viel weniger Geld als so manch anderes Spektakel. Daher ist es für mich auch so schwer nachvollziehbar, dass man für diese paar Euro den Politikern so lange nachlaufen muss. Denn wenn man betrachtet, was damit positives geschieht, dann zahlt sich hier jede Investition vielfach aus. Man muss aber immer wieder dahinter sein.
Sie sind Priester, Ihr Nachfolger ebenso. In anderen Diözesen sind Laien Caritasdirektoren. Sehen Sie einen Vorteil darin, wenn Priester die Caritas leiten?
Omelko: Sagen wir so: Ich habe meine Theologie ordentlich studiert und damit eine Grundlage für das Menschenbild. Ich will damit nicht sagen, dass es andere nicht haben. Aber durch die Beschäftigung mit Jesus Christus, dem Heil und der Erlösung ist eine Voraussetzung auch im Umgang mit Menschen da, die in Schwierigkeiten sind. Ich mache viele Feiern und Gottesdienste, wo man aus seiner Überzeugung heraus vieles sagen kann.
Was hat Sie als Priester geprägt?
Omelko: Ich wurde 1960 geweiht und habe den Aufbruch in der theologischen Denkweise massiv und sehr anregend erlebt. Als Jugendseelsorger hat mich vor allem Kardinal Cardijn sehr geprägt. Sein „Sehen, urteilen, handeln“ ist eine einfache Regel, die gerade für die Caritas auch immer stimmt. Es geht darum, die Menschen erst zur Kenntnis zu nehmen und dann erst etwas zu sagen. Zweitens habe ich ja auch Soziologie studiert. Die Verbindung der beiden Studien ist besonders spannend. Ich habe mich auch mit der Verzahnung der beiden intensiv beschäftigt. Das war eine perfekte Vorbereitung für die Caritas. Ich bin sehr froh, dass ich diese Chance hatte.
War das ausschlaggebend dafür, dass Sie von Bischof Köstner zum Caritasdirektor ernannt wurden?
Omelko: Eigentlich war ich ja nicht für diesen Posten vorgesehen. Aber als die Entscheidung anstand, haben offenbar einige den Gedanken an Bischof Köstner herangetragen, mich zu nehmen. Als er mich dann fragte, habe ich gerne zugestimmt. Obwohl die Caritas damals ja noch ganz anders war, viel kleiner. Einer sagte zu mir sogar: „Auf dieses Abstellgleis lässt du dich stellen!“ So ändern sich die Zeiten.
Nach 40 Jahren endet nun Ihre Tätigkeit in der Caritas. Gehen Sie mit Wehmut?
Omelko: Für mich ist die Arbeit als Caritasdirektor die schönste Aufgabe innerhalb der Kirche. Ich bin nicht wehmütig, sondern dankbar, dass ich 40 Jahre lang diese Arbeit tun durfte. Sie ist aber so spannend und erfüllend, dass ich mir schon noch viele neue Projekte vorstellen könnte.
Dr. Viktor Omelko im Ruhestand – ein Zustand, den man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Wie geht es Ihnen dabei?
Omelko: Ich schaffe es schon, drei Wochen auf Urlaub zu sein und nichts zu tun. Aber ich mache mir keine Sorgen, denn zu tun gibt es ja immer etwas. Wenn man Arbeit sehen will, findet man sie auch. Ich wohne ja weiter im Caritas-Haus gemeinsam mit einer Schwesterngemeinschaft. Wir haben eine Hauskapelle. Da feiern wir täglich Gottesdienst. Das begleitet mich also weiter.

__large.png)