Das Verhältnis der Kirche zu den Juden
Überlegungen zu 60 Jahre "Nostra aetate"
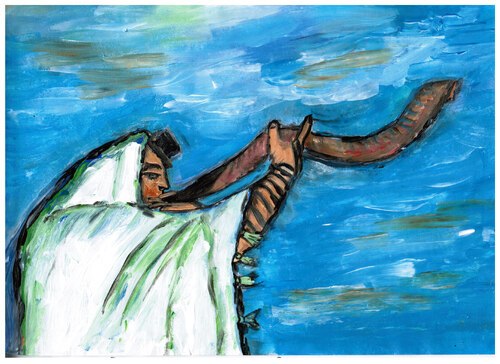
Dieses Mail trifft mich völlig unvorbereitet. Es stammt von Markus Himmelbauer, einem guten Bekannten und ausgewiesenen Kenner des christlich-jüdischen Dialogs. Er berichtet darin von seinem Urlaub in Kärnten und legt auch gleich ein Foto bei. Darauf befindet sich jedoch weder ein smaragdfarbener See noch ein Berggipfel zu Sonnenaufgang. Auf dem Foto ist vielmehr ein Detail einer Informationstafel zu sehen. Diese Tafeln haben Klaus Einspieler und ich in den letzten Jahren anlässlich des Tags des Judentums in Kärntner Kirchen aufgestellt, um auf judenfeindliche Kunstwerke hinzuweisen und diese theologisch aufzuarbeiten. Auf dem Foto ist deutlich zu erkennen, dass jemand mit einem Stift Wörter durchgestrichen und eine antijüdische Anmerkung hinzugefügt hat. Diese Schmierereien lassen sich auf der Folie der Informationstafel mit einem handelsüblichen Nagellackentferner rasch und ohne Rückstände beseitigen. Anders verhält es sich mit dem Widerhall, den diese Aktion in mir hervorgerufen hat. Bislang wurden unsere Beiträge weitgehend offen aufgenommen. Auch wenn es die eine oder andere kritische Stimme gegeben hat, sind antijüdische Kommentare ausgeblieben. Am 28. Oktober 2025 jährt sich zum 60sten Mal der Beschluss der Erklärung „Über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen – Nostra aetate“ am Zweiten Vatikanischen Konzil. Ich nehme dieses Jubiläum zum Anlass für eine Relecture dieses Textes und um diese antijüdische Aktion in einer Kärntner Kirche einzuordnen.
Ein bahnbrechender Text
Nostra aetate nimmt zunächst das Verhältnis der Kirche zu nichtchristlichen Religionen in den Blick. Dabei wird gewürdigt, was in den Religionen wahr und heilig ist (NA 2). Zugleich wird mit dem Johannesevangelium betont, dass die Menschen in Christus als dem Weg, der Wahrheit und dem Leben (s. Joh 14,6) die Fülle des religiösen Lebens finden. Nach einem eher knapp gehaltenen Hinweis zu Hinduismus und zu Buddhismus und einer Bezugnahme auf den Islam, kommt das Konzil in Artikel 4 ausführlich auf das Judentum zu sprechen. Dabei hält das Konzil fest, dass Israel ein Teil christlicher Identität ist, christlicher Antisemitismus zu beklagen und abzulehnen ist und Israels Erwählung aufrecht bleibt. Diese Erklärung bewirkte, so der jüdische Theologe Edward Kessler, „dass an die Stelle der bisher dem Christentum innewohnenden Verurteilung des Judentums die Verurteilung des christlichen Judenhasses trat.“
Eine Verhältnisbestimmung
Für Papst Johannes Paul II. macht Nostra aetate klar, dass es sich bei Judentum und Christentum nicht um zwei voneinander getrennte Religionen handelt, sondern Juden, wie der Papst immer wieder hervorgehoben hat, „unsere älteren Brüder im Glauben“ sind. Damit übersetzt er folgende Kernaussage von Nostra aetate in eine unmittelbar nachvollziehbare „verwandtschaftliche“ Beziehung: „Bei der Besinnung auf das Geheimnis der Kirche gedenkt die Heilige Synode des Bandes, wodurch das Volk des neuen Bundes mit dem Stamme Abrahams geistlich verbunden ist.“ (NA 4) Der jüdisch-christliche Dialog begleitete das gesamte Pontifikat dieses Papstes und mündete schließlich am Aschermittwoch 2000 in die Vergebungsbitte für das Unrecht, das die Kirche Juden zugefügt hat.
Theologische Irritationen
In den letzten 60 Jahren blieben jedoch Irritationen nicht aus. Besonders schwer wiegt wohl die im Jahr 2007 erneuerte Karfreitagsfürbitte des alten Ritus. Plötzlich ist darin wieder von der Mission an Juden die Rede. Damit bleibt diese Fürbitte deutlich hinter Nostra aetate und der Karfreitagsfürbitte der erneuerten Liturgie zurück. Dort wird betont, dass Gott zu den Juden zuerst gesprochen hat und dafür gebetet, dass er ihnen „die Gnade gebe, sein Wort immer tiefer zu verstehen und in der Liebe zu wachsen.“
Der Schatten des siebten Oktobers
Der siebte Oktober wird, so der Jesuit Christian M. Rutishauser, wie 9/11 eine Zäsur markieren und „seine Spuren hinterlassen – im Nahostkonflikt wie auch in den jüdisch-christlichen Beziehungen“. Daran ändern auch die kürzlich erfolgte Freilassung der Geiseln und der Nahost-Friedensplan nichts. Denn schwer wiegt der Vorwurf namhafter im christlich-jüdischen Dialog engagierter Juden, dass nach dem Massaker der Hamas Christen nicht aktiv Partei ergriffen und sich nicht deutlicher gegen ein erneutes Aufflammen des Antisemitismus in Europa gestellt haben.
Dialog als ständiger Auftrag
Wie so oft in den letzten Tagen öffne ich das Foto auf meinem Laptop und frage mich: Was hat diese Person dazu bewogen, unsere Info-Tafel mit einer antijüdischen Aussage zu versehen? War dies eine spontane Aktion oder ein wohl überlegtes Tun? Wurde sie dabei beobachtet? Und schließlich: Wie viele Menschen haben diesen antijüdischen Kommentar gelesen, bevor wir auf ihn aufmerksam gemacht wurden? Die Fragen bleiben. Fest steht jedoch für mich, dass wir als Christen allen Formen von Antisemitismus und Antijudaismus entgegentreten müssen und dass wir, wie Nostra aetate betont, Gott nur anrufen können, wenn wir jeden Menschen als Ebenbild Gottes sehen, ihm bzw. ihr mit einer Haltung der Wertschätzung begegnen und den Dialog suchen.
